JUPITER eingeweiht: Exascale für Europa
Vor hochrangigen Gästen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft hat das FZJ am 5. September den ersten europäischen Exascale-Supercomputer JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research) der Öffentlichkeit vorgestellt. Das System ist darauf ausgelegt, eine Rechenleistung von mehr als 1 ExaFlop/s zu erreichen, bei KI-Anwendungen sogar mehr als 40 ExaFlop/s. Damit wird es möglich, besonders große KI-Modelle zu trainieren und anzuwenden sowie Simulationen mit bislang unerreichter Detailtiefe durchzuführen. Einsatzfelder liegen unter anderem in der Klima- und Energieforschung, der Materialwissenschaft sowie in der Medizin. Am großen Festakt für den schnellsten und energieeffizientesten Rechner Europas nahmen auch Bundeskanzler Friedrich Merz und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst teil. Finanziert wird JUPITER zur Hälfte durch das EuroHPC Joint Undertaking sowie zu je einem Viertel vom Bund und vom Land NRW über das GCS. Weitere Informationen: go.fzj.de/jupiter-einweihung .
Neues Rechenzentrum an der Universität Mainz
Am 25. August hat die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ihr neues Rechenzentrum offiziell in Betrieb genommen. Der Neubau vereint nach zweijähriger Bauzeit die gesamte universitäre IT-Infrastruktur und die Hochleistungsrechner des Nationalen Hochleistungsrechnens (NHR), darunter MOGON NHR Süd-West. Damit erhält der Wissenschaftsstandort Mainz eine zentrale Einrichtung, die höchste Verfügbarkeit, Sicherheit und Effizienz für Forschung, Lehre und Verwaltung gewährleistet. Vier Schutzzonen und ein modernes Zutrittssystem sichern sensible Daten, während eine Photovoltaikanlage, der kombinierte Einsatz von Kalt- und Warmwasserkühlung sowie die geplante Nutzung der Abwärme wesentliche Beiträge zur Energieeffizienz leisten. Mit einem Investitionsvolumen von fast 31 Mio. Euro stellt das Projekt eine bedeutende Stärkung der digitalen Infrastruktur und HPC-Forschung in Mainz dar. Weitere Informationen: presse.uni-mainz.de/neues-rechenzentrum-auf-dem-gutenberg-campus-eroeffnet/ .
SuperMUC-NG simuliert detailgenau Turbulenz
Eine internationale Forschungskooperation berechnete auf dem SuperMUC-NG des LRZ die bisher größten Simulationen von Magnetismus und Turbulenz im interstellaren Medium (ISM) in bisher unerreichter Detailgenauigkeit. Ein Forschungsteam um James Beattie, promovierter Astrophysiker an der Princeton University und am Canadian Institute for Theoretical Astrophysics der University of Toronto, untersuchte, wie Magnetfelder die hochgradig turbulenten Bewegungen im interstellaren Medium (ISM) beeinflussen. Beteiligt waren auch Wissenschaftler:innen der Australian National University und der Universität Heidelberg. Die Simulationsergebnisse stellen langjährige Annahmen über die Rolle magnetischer Turbulenz infrage und zeigen auf, wo weitere Forschung für Weltraum-Experimente ansetzen sollte. Die Ergebnisse veröffentlichte das Fachmagazin Nature Astronomy. Weitere Informationen: lrz.de/news/detail/supermuc-ng-simuliert-detailgenaue-turbulenz .
Simulation von Elektronen für sichere Fusionsenergie
Forschende am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik haben mit Unterstützung des HLRS das Verhalten sogenannter Runaway-Elektronen realitätsnah simuliert. Die hochenergetischen Teilchen entstehen bei Plasmastörungen und können Reaktorwände beschädigen. Um dieses Phänomen besser zu verstehen, hat das Team ein hybrides fluid-kinetisches Modell in den MHD-Code JOREK integriert und mithilfe der Rechenleistung des HLRS mit Modellen für Plasmadynamik gekoppelt. Die Berechnungen erlauben detaillierte Einblicke in die Entstehung und das Verhalten der Teilchen unter realistischen Bedingungen. In einem nächsten Schritt sollen längere Zeitskalen und größere Plasmavolumina auf künftigen HPC-Systemen modelliert werden – mit dem Ziel, realitätsnahe Simulationen des Fusionsreaktors ITER zu ermöglichen und die Entwicklung stabiler Fusionsreaktoren voranzubringen. Weitere Informationen: hlrs.de/de/news/detail/simulation-von-runaway-elektronen-in-fusionsreaktionen .
Neues 10B-Modell für drei Sprachen
Das Team „Big Data & Artificial Intelligence (BDAI)“ am LRZ hat gemeinsam mit Partnern das trilinguale Sprachmodell Llama-GENBA-10B entwickelt. Es basiert auf Metas Llama-Modell (Version 3.1-8B), umfasst 10 Mrd. Parameter und wurde mit einem Datensatz von 164 Mrd. Token auf dem Cerebras CS-2 System am LRZ trainiert. Llama-GENBA-10B ist als inklusives und ressourceneffizientes Basismodell konzipiert und kann Texte in Englisch, Deutsch und Bayerisch generieren sowie übersetzen. In einem Preprint beschreibt die Gruppe die Methode und die besonderen Herausforderungen beim Training und vergleicht die Leistungsfähigkeit des Modells mit anderen Sprachmodellen wie Apertus-8B, gemma-2-9b oder EuroLLM-9B. Weitere Informationen: lrz.de/news/detail/lrz-entwickelt-10b-sprachmodell .
Testbed für Quantenkommunikation startet
Am RRZE entsteht derzeit ein lokales Testbed zur Integration quantenbasierter Schlüsselverteilung (QKD) in bestehende HPC- und Campusnetzwerke. Ziel ist es, praxisnahe Konzepte für den Einsatz von Quantenkommunikation im wissenschaftlichen Netzwerkbetrieb zu erproben – zunächst innerhalb der FAU, perspektivisch auch mit Anbindung an das LRZ. Der Aufbau des Testbeds erfolgt in zwei Stufen: Aktuell konzentrieren sich die Vorbereitungen auf den Aufbau der neuen Quantenverschlüsselungsgeräte lokal am RRZE. In einem nächsten Schritt soll eine Verbindung zum NHR@FAU eingerichtet werden. Die Erweiterung hin zum LRZ ist technisch herausfordernder, da größere Distanzen derzeit nur mit vertrauenswürdigen Knoten überbrückt werden können – eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist hier momentan noch nicht möglich. Die eingesetzte Hardware wurde durch den Freistaat Bayern finanziert. Das Vorhaben ist Teil eines vom DFN-Verein geförderten Projekts des WiN-Labors am RRZE. Weitere Informationen: go.fau.de/1caag .
Effiziente Forschungssoftware für HPC
Der Einsatz von Computermodellen nimmt in allen Wissenschaftsbereichen stetig zu. Doch die Entwicklung neuer Forschungssoftware für HPC-Systeme erfordert spezielle Kenntnisse, die viele Forschende nicht mitbringen. Hier setzt das Landesprojekt bwRSE4HPC an: Das durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg geförderte, mehrstufige Unterstützungsangebot des KIT und der Universität Heidelberg berät erfahrene HPC-Nutzer:innen ebenso wie Einsteiger:innen in ihrer softwaregestützten Forschung. Mit den Fachleuten wird die Forschungssoftware verbessert – effizienter parallelisiert, auf neue Hardware portiert oder nutzerfreundlich gestaltet. Auch die Entwicklung von Prototypen zum Testen neuer Methoden oder die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit sind denkbar. Ziel ist zuverlässigere und leistungsfähigere Software für die wissenschaftliche Praxis. Forschende können sich über ein Online-Formular mit einer konkreten Fragestellung direkt bewerben. Weitere Informationen: bwrse4hpc.de .
Gordon-Bell-Preisnominierung für ICON-Simulationen
Zwei Projekte mit dem Klimamodell ICON sind für den renommierten Gordon-Bell-Preis für Klimamodellierung nominiert. Eine neue ICON-Konfiguration simuliert das gesamte Erdsystem inklusive Energiehaushalt, Wasser- und Kohlenstoffkreislauf bei einer Auflösung von 1,25 km erstmals mit einer Performance, die Simulationen über mehrere Jahrzehnte ermöglicht. Ein vom Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPI-M) und dem DKRZ geleitetes Team hat diese ICON-Konfiguration entwickelt. Technische Optimierungen nutzen CPUs und GPUs moderner Supercomputer optimal aus, steigern den Rechendurchsatz und senken den Energieverbrauch auf ein Drittel gegenüber einer reinen CPU-basierten Simulation. Die Konfiguration lief bereits erfolgreich auf „Alps“ am Swiss National Supercomputing Centre und wird für Europas größten Supercomputer JUPITER vorbereitet. Auch der Destination Earth Climate Adaptation Digital Twin, der die Modelle ICON, IFS-FESOM und NEMO nutzt und Klimainformationen direkt für Nutzer:innen zugänglich machen will, wurde nominiert. Hier sind MPI-M und DKRZ ebenfalls mit ICON beteiligt. Die Verleihung des mit 10.000 US-Dollar dotierten Gordon-Bell-Preises findet im November auf der Supercomputing-Konferenz SC25 in St. Louis statt. Weitere Informationen: dkrz.de/de/gordon-bell-preis/ .
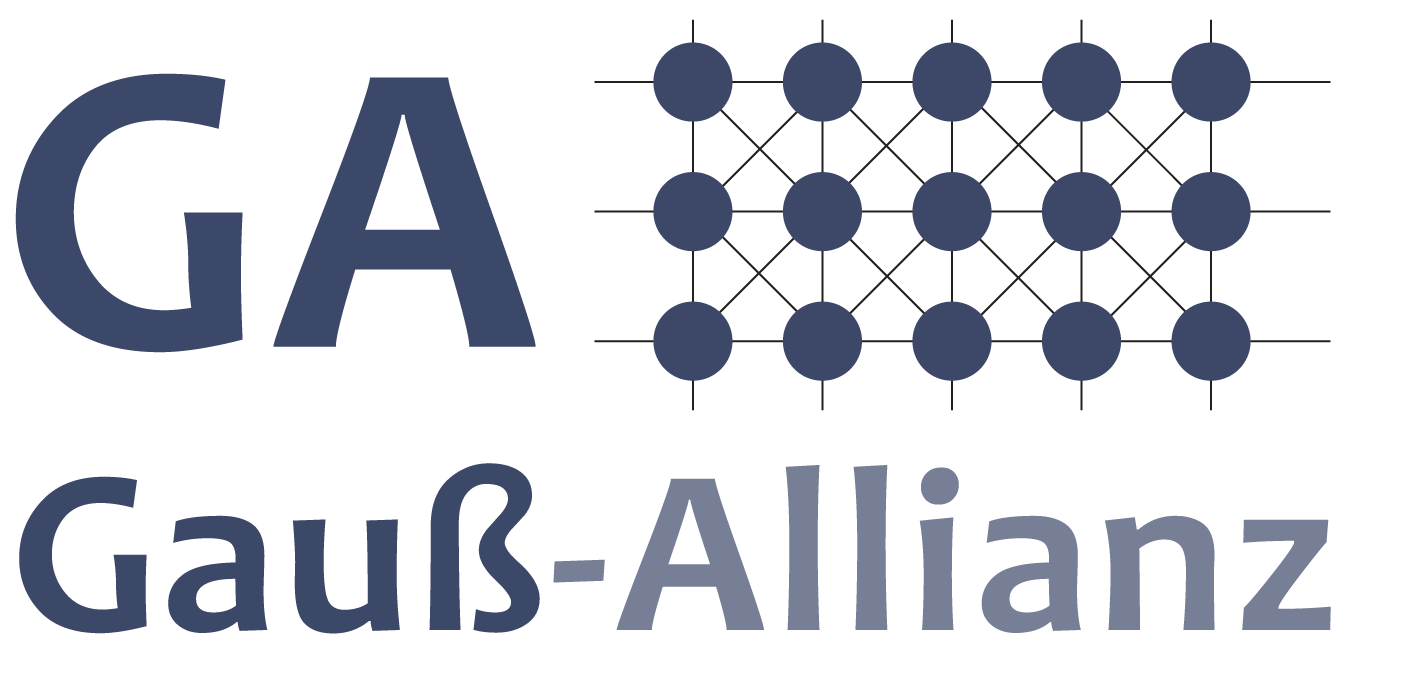

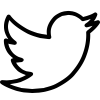

 Subscribe
Subscribe